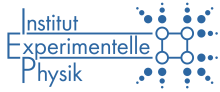
Das Institut für Experimentelle Physik arbeitet an der Schnittstelle von Kristallographie und Festkörperphysik zur Entwicklung neuer und innovativer Funktionsmaterialien vorwiegend im Bereich der Energiewandlung und -speicherung. Mehrere interdisziplinäre Arbeitsgruppen befassen sich für die entsprechenden Substanzklassen mit der Synthese und der Aufklärung von Struktur-Eigenschaft-Beziehungen. Dazu beteiligt sich das Institut für Experimentelle Physik aktiv am Ausbau und Unterhalt des Zentralen Reinraumlabors der TU Bergakademie Freiberg und betreibt die Strukturaufklärung mittels Röntgenstrahlung mit besonderem methodischen Anspruch. Unter Leitung des Insitutsdirektors Dirk C. Meyer befindet sich ebenfalls das Zentrum für effiziente Hochtemperatur-Stoffwandlung ZeHS. Darüber hinaus ist das Institut in ein aktives Kooperationsumfeld eingebunden und hat enge Verbindungen zu internationalen Großforschungseinrichtungen (in Deutschland sind dies u. a. European XFEL, DESY und BESSY).
In der Geschichte der TU Bergakademie Freiberg spielte die Physik als solche zunächst eine untergeordnete Rolle. In den ersten Jahrzehnten wurde die physikalische Ausbildung von Mathematikern, Chemikern und Kristallographen mit abgedeckt. Erst im Jahre 1826 wurde eine von der Mathematik getrennte, ordentliche Professur für Physik eingerichtet, auf die Ferdinand Reich berufen wurde. Berühmt wurde er durch seine Fallversuche im Drei-Brüder-Schacht bei Brand-Erbisdorf und, zusammen mit Hieronymus Theodor Richter, durch die Entdeckung des chemischen Elements Indium. Außerdem sorgte er durch Beschaffung einer Kopie des Urmeters aus Paris für die Einführung des metrischen Systems in Sachsen.
Heimstätte der Physik in Freiberg war zunächst das Gebäude in der Silbermannstraße. Im Jahre 1956 wurde ein zweites physikalisches Institut eingerichtet, das mit den Vorlesungen zur Experimentalphysik und den seinerzeit „modernen“ Fachrichtungen wie Atom-, Kern- und Festkörperphysik betraut wurde. Es setzte damit die Tradition des im Jahr 1948 aufgelösten Radiuminstituts fort. Zusammen mit dem im Jahr 1940 geschaffenen Institut für Geophysik und dem im Jahr 1951 gegründeten Institut für Theoretische Physik gab es seitdem vier physikalische Institute an der Bergakademie. Im Jahr 2005 bezogen schließlich die drei in der Fakultät für Chemie und Physik angesiedelten Institute für Angewandte, Experimentelle und Theoretische Physik gemeinsam den sanierten Gellert-Bau in der Leipziger Straße 23 (im Bild oben der Blick von der Straße zum Haupteingang).

Prof. Dr. Dirk C. Meyer
Institutsdirektor IEP
Raum: GEL OG.05 / ZeHS 1.108
Tel.: +49 (0)3731 39 2860 (Gellert-Bau)
Tel.: +49 (0)3731 39 1501 (ZeHS)
dirk-carl [dot] meyer [at] physik [dot] tu-freiberg [dot] de (dirk-carl[dot]meyer[at]physik[dot]tu-freiberg[dot]de)

Dr. Claudia Funke
Geschäftsführerin IEP
Raum: GEL OG.31
Tel.: +49 (0)3731 39 2084
claudia [dot] funke [at] physik [dot] tu-freiberg [dot] de (claudia[dot]funke[at]physik[dot]tu-freiberg[dot]de)

Stefanie Schmidt
Sekretariat IEP
Raum: GEL OG.06
Tel.: +49 (0)3731 39 2892
schmidt [dot] stefanie [at] physik [dot] tu-freiberg [dot] de (schmidt[dot]stefanie[at]physik[dot]tu-freiberg[dot]de)